
|

|
|
|
| Übersicht |
| Pflanzenphysiologie |
| Bakteriologie |
| Pflanzenphysiologisches Institut |
| Popularisierung der Wissenschaften |
Das Pflanzenphysiologische Institut
Cohn gründete 1866 das erste selbständige pflanzenphysiologische Institut in Preußen. Hatte sich der deutsch-französische Krieg von 1870/71 noch hemmend auf die Entwicklung des Pflanzenphysiologischen Instituts in Breslau ausgewirkt, so nahm es in den folgenden Jahren einen umso eindrucksvolleren Aufschwung. In der Folge war es mehr als 15 Jahre weltweit lang Zentrum für Mikrobiologie und Bakteriologie, das in ständigem Kontakt nicht nur mit deutschen und europäischen Instituten stand, sondern auch mit Instituten in Übersee wie beispielsweise in Indien.
Bereits 1847 hatte Cohn, seiner Zeit weit vorauseilend, in seiner Dissertation "Symbola ad seminis physiologiam" (Beiträge zur Physiologie des Samens) die Gründung pflanzenphysiologischer Institute aufgrund der wachsenden Entdeckungen in allen naturwissenschaftlichen Bereichen für notwendig erachtet. Das erste pflanzenphysiologische Institut auf deutschem Boden gründete 1864 sein Freund Nathanael Pringsheim nach seiner Berufung an die Universität in Jena. Bei der Gründung und in der Anfangsphase von Cohns Instituts in Breslau galt es, zahlreiche Probleme zu überwinden. Zum einen war das Unterrichtsministerium nicht geneigt, die Gründung eines Spezialinstituts zu fördern, nachdem zu diesem Zeitpunkt noch kaum allgemeine botanische Institute an den deutschen Universitäten bestanden. Zum anderen fand Cohn innerhalb seiner Fakultät keine große Unterstützung für sein Projekt, weil der Inhaber des ersten botanischen Lehrstuhls, der Paläobotaniker Heinrich Göppert, die Ansicht vertrat, bei ihm werde Forschung nach den modernsten Gesichtspunkten betrieben. Des weiteren musste sich Cohn unter heutzutage unvorstellbar schwierigen Bedingungen mit ungeeigneten Räumen und mangelnder Ausstattung zufrieden geben; oft schaffte er kostspielige Apparate, insbesondere Mikroskope, auf eigene Kosten an. Aber Not macht auch erfinderisch, wie das untenstehende Bild zeigt, auf dem eine Art Punschbowle zur Anzucht seines Algenmaterials zu sehen ist.
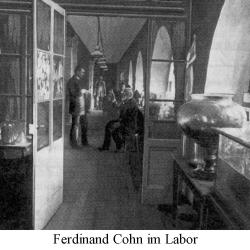
Die erste Finanzierung kam schließlich vom Landwirtschaftsministerium. Dadurch wurde Cohn verpflichtet, sich vorrangig um die Belange und Probleme der Landwirtschaft zu kümmern. Auf diesem Gebiet hatte er bereits in jungen Jahren geforscht und 1847 seine Ergebnisse in seiner Dissertation unter dem Titel "Symbola ad seminis physiologiam" veröffentlicht. Sie befasst sich mit Samenbildung, Samenreifung und Keimen unreifer Samen. Ab 1866 bildete daher die Samenforschung sowohl theoretisch als auch praktisch einen wesentlichen Schwerpunkt an seinem Pflanzenphysiologischen Institut und führte 1870 zur Einrichtung einer provisorischen Samenprüfanstalt. 1875 wurde in eine feste Institution unter Leitung seines langjährigen Assistenten Eduard Eidam (1845–1901) umgewandelt.
Cohn hatte sich zum Ziel gesetzt, Forschung und Lehre an seinem Institut zu betreiben nach den Prinzipien der Einheit von Forschung und Lehre von Wilhelm von Humboldt (1767–1835), deren Umsetzung damals durchaus nicht üblich war. Er bildete viele junge Leute aus, die später namhafte Forscher und Leiter eigener Institute wurden. Sie verbreiteten seine Vorstellungen und Arbeitsmethoden weit über das Land, so dass in Fachkreisen von der "Breslauer Schule" gesprochen wurde. Zu ihnen gehörten:
Leopold Just (1841-91), einer seiner ersten Doktoranden, der 1873 an das Polytechnikum Karlsruhe berufen wurde und dort das botanische Institut, den botanischen Garten und die Samenprüfanstalt begründete.
Oskar Kirchner (1851-1925), der als Nachfolger von Prof. Franz von Fleischer (1801–1878) an die Land- und Forstwirtschaftliche Akademie nach Hohenheim berufen wurde und ab 1878 den Lehrstuhl für Botanik inne hatte.
Julius Kühn (1825-1910), der die moderne Landwirtschaftswissenschaft begründete.
Hugo Conwentz (1855-1922), Direktor der Danziger Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege Preußens in Danzig, der den Naturschutzbund gründete.
Eduard Eidam, einer seiner verdienstvollsten Mitarbeitern, der ab 1870 Leiter der Samenkontrollstation Breslau war.
Cohns Jahresberichte an das Unterrichtsministerium belegen eindrucksvoll die zentrale Rolle, die sein Institut in der bakteriologischen Forschung und Lehre über Jahrzehnte spielte.
Bereits 1872 waren die Forschungsarbeiten von Cohn und seinen Mitarbeitern am Institut so umfangreich geworden, dass er beschloss, eine eigene wissenschaftliche Zeitschrift "Beiträge zur Biologie der Pflanze" herauszugeben, die bis 1946 erschien. In dieser Zeitschrift hat Robert Koch 1876 seine erste aufsehenerregende wissenschaftliche Abhandlung "Die Aetiologie der Milzbrand-Krankheit..." veröffentlicht.
An Cohns Institut wurden seit 1871 erste Mikrofotografien gemacht, die Robert Koch dazu anregten, diesen Bereich zu perfektionieren. Eine enge Zusammenarbeit bestand mit dem pathologischen Institut, an dem Carl Weigert (1845-1904) und Paul Ehrlich (1854-1915) die Färbemethoden mit Anilin entwickelten.
Nachdem die räumliche Beengtheit durch die wachsende Forschung und Bewältigung von Problemstellungen unerträglich geworden war, wurde Cohn 1888 ein neues Institut im Botanischen Garten von Breslau zugestanden.
designed by jk-websolutions